Als wollten wir bleiben – ein Essay
Johanna Jacobi ist Theaterkünstlerin und Wortschmiedin aus London und dem Fünf-Seenland in Bayern. Das Thema Heimat bewegt sie sehr. Sie stellt Fragen wie: Was bedeutet es, in sich selbst oder an einem bestimmten Ort zuhause zu sein? Was bedeutet Heimkehr? Was bedeutet es, Wurzeln zu schlagen? Sollten wir als globale Gemeinschaft die ganze Erde als unsere Heimat sehen? Und wie kann eine Gesellschaft, die nirgends „einheimisch“ ist, in eine gesunde Beziehung zur “Mehr-als-menschlichen-Welt” eintreten? Ein selbstreflexives Essay mit Tiefe.

Der Schatz am Ende des Regenbogens – Johanna Jacobi
Jeder nimmt sich immer selbst mit
Ich bin achtzehn, sitze in der herbstlichen Dämmerung in Richmond Park an der Seite des Weges in der roten Erde. Die weite Landschaft leert sich langsam bis auf das freilaufende Wild. Eine besorgte Spaziergängerin fragt mich, ob alles in Ordnung sei, und ich sage – ungerechterweise ein bisschen verärgert über ihre Aufmerksamkeit – “ja, danke”.

Heimat DeSelfie – Danke an Nicky-Pe Pexels
Meine Mutter würde wahrscheinlich sagen, dass ich sowieso schon immer am liebsten bis zu den Knien im Matsch stand. Ich war endlich als Au-pair auf Großbritannien, der Insel, die ich mir vor Jahren als Wahlheimat ausgesucht hatte. Allerdings hatte ich gar keinen besonderen Wunsch nach London in die Großstadt zu ziehen. Ich wollte einfach auf eine gescheite Schauspielschule und am allerliebsten in Naturnähe.
Hier war ich nun und hatte mir den größten Landschaftspark gesucht, den ich in nächster Nähe finden konnte. Und obwohl ich mich immer noch in der Einflugschneise von Heathrow befand, konnte ich mich nur schwer trennen. Sechs Jahre war London meine Heimat, und das Leben in der Großstadt lehrte mich immer wieder, die vermeintliche Getrenntheit zwischen Stadt und Land, zwischen Zivilisation und Wildnis, zwischen Kultur und Natur zu hinterfragen. Und über meine Verbundenheit mit diesen Lebensräumen nachzudenken.
Heimat: emotional aufgeladen
Heimat ist ein komplexes und emotional aufgeladenes Thema. Heutzutage gehen Menschen sowohl auf die Straße, weil sie sich von anderen bedroht fühlen, die nach einer neuen Heimat suchen, ihre alte verloren haben – möglicherweise verschuldet von Strukturen, von denen Bürger europäischer Nationen seit Generationen profitieren. Mehr Menschen werden nach neuer Heimat suchen indes sich die Klimakrise verschärft. Währenddessen versuchen Schulkinder Politiker zu überzeugen, dass wir eine lebensfreundliche Erde als Heimat schützen sollten.
Heimat bedeutet uns viel und viel mehr als Nation. Letztes Jahr saß ich mit einem früheren Schauspiellehrer beim Mittagessen, der nicht verstehen konnte, wieso ich überhaupt noch in London war: In diesem Land ginge doch eh alles bergab. Ich gab verschiedene Gründe an, warum ich das Land liebe: „the land, not the nation and politics.“ Das ergab für ihn keinen Sinn. Doch auch London, ein ausuferndes Zentrum menschlicher Zivilisation, habe ich als Landschaft und Ökosystem kennengelernt. Wie oft sehen wir die nicht-menschlichen, nicht von Menschen konfigurierten Elemente dieser Welt, als nebensächlich? Wie entwurzelt und einsam werden wir durch diese Perspektive, zumal sie nicht der Realität entspricht?
Ein letztes indigenes Volk in Europa
Vor einiger Zeit las ich, dass die Sámi das letzte indigene Volk Europas sind – die wenigen übriggebliebenen Ureinwohner meines Heimatkontinents. Das zu lesen tat weh. Zum einen, weil ich es als Verlust empfinde, wenn naturverbundene Lebensarten in Vergessenheit geraten. Ich finde es ungerecht, wenn Menschen ihre Kultur und Heimat entrissen werden. Aber der Satz sprach auch von einem Verlust, den ich persönlich empfand: Ich bin zu einem bedeutsamen Teil in meiner eigenen Heimat nicht einheimisch. Was irgendwie bedeutet, dass ich gar nirgends einheimisch bin.
Ich halte die Kategorisierung nicht für verkehrt. Eine Kultur als indigen zu bezeichnen, impliziert nach meinem Verständnis, wie ich es aus Texten wie “Geflochtenes Süßgras” von Robin Wall Kimmerer erschließe, unter anderem, die Anerkennung einer wechselseitigen Beziehung zwischen Mensch und Umwelt auf gesellschaftlichem Level. Denn das bedeutet es, einen Ort gemeinschaftlich als Heimat zu bezeichnen. Und das braucht Selbstreflexion.

Nirgendwo zuhause – Foto: Johanna Jacobi
Selbstreflexion: Der Mensch als Teil der Natur?
Ich frage mich, ob wir ein Recht haben, ein Stück Erde unsere Heimat zu nennen, welches wir so fantasielos und brutal ausbeuten. Und das, während wir zugleich auch die Heimat anderer ausbeuten. Gewiss, ein Schäfer im Lake District, oder auch ein Metzger im Massenschlachthaus, oder ein Büroangestellter in einer Großstadt, wird sich jeweils einer anderen persönlichen Beziehung zu seiner Umwelt mehr oder weniger bewusst sein.
Aber auf systemischer Ebene sind wir unserer Heimat entwurzelt, und die Folgen von Kolonialisierung und Industrialisierung – soziale Ungerechtigkeiten, Massentierhaltung, Klimawandel und Arbeitsentfremdung – zeigen uns, wie gefährlich diese Entwurzelung für uns alle wird. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen.
Wandel braucht lange, aber ich denke, wir können viel lernen von Menschen, die noch wissen, dass sie der Erde gehören, und nicht umgekehrt. Welche Perspektiven eröffnen sich, wenn wir indigene Begriffe von Heimat wirklich zu verstehen versuchen – und beginnen, auf unser Leben anzuwenden? Nicht indem wir kulturelle Elemente übertragen, sondern indem wir selbst eine praktische, emotionale und spirituelle Beziehung mit unserer Heimat, diesem Planeten, aufbauen?
Lebendige Beziehung zur nicht-menschlichen Welt
Was ich als Kind von den Ureinwohnern anderer Kontinente und des hohen Nordens hörte, war mir immer zugleich fremd und tief vertraut. Ich lernte von einer Zeit zu träumen, in welcher wir Menschen die Welt um uns herum als lebendig wahrnehmen können. Mythen von Verwandlungen in andere Tiere waren für mich Manifestation von dem inneren Wissen, dass wir als Menschen auch der Welt der Tiere angehören.
Diese Verwandtschaft empfand ich auch ganz bestimmt nicht als negativ, unzivilisiert oder gar kulturlos, wie sie weitgehend in der europäisch und euro-amerikanischen Kultur dargestellt worden ist. Aus dem historischen Kontext heraus ist es mir wichtig anzuerkennen, dass die Assoziation indigener Völker mit dem Tiersein oft respektlos und abwertend gewesen ist. Im Gegenteil könnte ein Bewusstsein für diese Verwandtschaft hoffentlich aber die Entfremdung des Menschen von „natürlichen“ Beziehungen hinterfragen.
Lebendige Beziehung zur nicht-menschlichen Welt
Obwohl manche der Geschichten, auf die ich als Kind traf, nicht aus Originalquellen stammten und auch mal kulturell vorverdaut waren, ich ihnen also heute mit kritischerem Verständnis begegnen würde, verdanke ich es ihnen, dass ich Interesse entwickelte an Konzepten von Kultur und Natur, in denen Menschen ihren Platz in der Familie der Lebewesen verstehen, ohne sich vom Rest der lebendigen Welt abspalten zu müssen.
In diesen Weltanschauungen fühlte ich mich oft aufgehobener als in der mir geläufigen, in der ich oft schockiert und verletzt war von der nebensächlichen Respektlosigkeit, mit der Tiere, Nahrung, und Umwelt behandelt wurden. Eine Nebensächlichkeit, die ich nicht vermeiden konnte, mir zu oft selbst anzugewöhnen. In den indigenen Kulturen, von denen ich hörte und las, war die lebendige Beziehung zur nicht-menschlichen Welt dagegen allgegenwärtig, respektvoll und selbstverständlich.
Nanabozho – erster Mensch und kleines Geschwisterchen
In „Geflochtenes Süßgras“ erzählt die Potawatomi Biologin Robin Wall Kimmerer aus dem Mythos von Nanabozho, dem ersten Menschen, der laut der Anishinaabe Schöpfungsgeschichten als letztes Wesen erschaffen wurde. Teils Mensch, teils mächtiges Geisterwesen, Manido. Nanabozho ist der Neuankömmling auf Turtle Island, oder Nordamerika, das kleine Geschwisterchen aller anderen Wesen, die ihren Platz im Kreislauf ihrer Heimat schon gefunden haben.

Zyklen der Natur – Foto: Johanna Jacobi
Nanabozho versteht, dass er nicht in eine neue Welt gekommen ist, sondern in eine alte. Er versucht mit allen seine Möglichkeiten zu lernen, heimisch zu werden, und den ursprünglichen Anweisungen, die ihm gegeben worden sind, zu folgen. (Kimmerer, 2021, 239). Seine älteren Geschwister, die Wesen, die schon länger auf Turtle Island leben, werden seine Lehrer.
Ich wünschte so eine Schöpfungsgeschichte wäre in Europa erhalten worden. Nanabozhos Geschichte bietet uns eine Weisheit, die in Genesis schwer zu finden, und einfach misszuverstehen ist. Es liegt nahe, einen Herrschaftsanspruch zu entwickeln aus der Anweisung, sich der „Erde […] untertan“ zu machen (Die Bibel, Genesis, 1.26-28). Das mag Ausdruck einer frühen Agrargesellschaft sein, die durch härteste Arbeit und unter schwierigen Bedingungen versuchte, sich und ihre Nachkommen zu ernähren.
Macht und Weisheit – Macht und Verantwortung
Auf lange Sicht hat uns der Machtanspruch, der durch solche Anweisungen religiös gerechtfertigt schien, in eine Situation versetzt, in der unsere übermäßige Kontrolle über die Umwelt nicht nur das Überleben unserer Spezies bedroht, sondern auch unzählige unserer „älteren Geschwister“ ausgelöscht hat. Wir haben noch nie da gewesene Macht über unsere Lebensumstände und moderne Technik und Medizin hat wirkliche Wunder ermöglicht.
In einem Schriftstellerseminar zitierte Manda Scott neulich Edward O. Wilson, der sagte, dass die moderne Menschheit ausgezeichnet ist durch „altsteinzeitliche Emotionen, mittelalterliche Institutionen […], und Götter-ähnliche Technologie” (Wilson bei „Big Think“, 2017). Jetzt brauchen wir die Weisheit, diese Macht mit Demut, in Balance mit dem Rest der lebendigen Welt auszuüben. Ich glaube, die Weisheit der Nanabozho-Erzählung ist verständlich und notwendig.
Kimmerer versteht die Relevanz auf noch weiterer Ebene, gerade in ihrer Beziehung zu europäischen Siedlern, die wie Nanabozho Neuankömmlinge waren in einer alten Welt. Sie zitiert die Ältesten ihrer Nation, die bis heute sagen, das Problem mit den Siedlern sei, dass sie eigentlich noch gar nicht richtig angekommen seien: sie hätten sich anscheinend noch gar nicht ganz entschieden, ob sie bleiben wollen (Kimmerer, 2021, 240).
Wir sind alle auf derselben Seite. Sind wir?

Danke an pexels und Julius Silver
Wurzellos und heimatlos, wie kann ein Volk von Immigranten, für die Amerika ein „Land der zweiten Chancen“ ist, dort heimisch werden? Das ist Kimmerers Frage, die für Europäer in Europa vielleicht unnötig scheint. Das hieße aber zu übersehen, auf welch dramatische Weise die Beziehung zu unserem Heimatkontinent vom Kolonialismus geprägt ist.
Ob es darum geht, dass deutscher Müll in andere Länder transportiert wird, so als könnten wir Dinge tatsächlich „weg“werfen (wo ist „weg“?); (Cwienk, 2019) oder um nebensächliches Jetsetting zu fernen Urlaubszielen. Oder um den massenhaften Import von Soja als Nahrung für Schlachttiere (WWF Deutschland, 2022). Mit dramatischen Auswirkungen machen die momentanen Lieferkettenprobleme auch die von uns, die nicht in diesem Bereich arbeiten, auf die komplizierten Zusammenhänge unserer Produktionsketten aufmerksam.
Haben wir noch Wurzeln in dieser Heimat?
Haben wir noch Wurzeln in dieser Heimat, eine wirkliche Verbindung zu Europa, zu den spezifischen Orten, die wir Heimat nennen? Ich denke, wir haben genug emotionale Verbindung, um wieder Wurzeln zu schlagen, wenn wir auch den Durchblick, die Ehrlichkeit, und den Mut haben, uns zu erinnern, dass der wahre Schatz dieser Erde die Erde selbst ist, die uns ernährt.
Wir teilen die Notwendigkeit für Heimat, Nahrung, und einen gewissen Grad Sicherheit, den Wunsch nach respektvollen und liebevollen Beziehungen mit unseren Mitmenschen, und nach Sinn, was auch immer das für jeden individuell bedeuten mag. Es tut weh, dass wir auf kollektiver Ebene noch nicht umsetzen, was doch eigentlich klar ist: Wir sind alle auf derselben Seite.
Lebendige Beziehungen zur Natur finden
In einer Stadt zu leben hat mir auf jeden Fall eines beigebracht: Um nach Beziehung zur Natur zu suchen, muss man nicht aufs Land fahren. Ich meine damit zum einen, dass es Wildtiere, Bäume, Licht, Wolken und kleine hartnäckige Disteln zu sehen gibt in der Stadt. Im Südosten Londons sind die Naturreservate der alten Great North Woods.
Ich wohnte vor reihenweise Schrebergärten, in deren Obstbäumen sich die Vögel zum Morgenchor versammeln. In der kleinen Fußgängerzone vor der Bahnstation wird seit Jahren ein Gemeinschaftsgarten mit Zier- und Nutzpflanzen und Heilkräutern gepflegt. Die Gezeiten der Themse erinnern einen, dass die Weite des Ozeans nahe ist.

Heimat. Danke an Jocelyn Erskinekellie pexels
Vor allem aber meine ich, dass wir immer in gelebter Beziehung zur Natur stehen. Das ist vielleicht für manche offensichtlich, ich musste es aber langsam verstehen: Wonach wir suchen, wenn wir in wildere, grünere Landstriche flüchten, ist eine Welt, die weniger menschlich beeinflusst scheint – weniger architektonisch und mehr organisch – und die Balsam für unser Nervensystem ist.
Aber zum einen sind diese Landstriche oft von Landwirtschaft geprägt, und zum anderen wurde jeder Stein in London von irgendwo hergeschafft: Jede Plastikverpackung war einmal Erdöl; Straßen folgen der lokalen Topographie, Hügel hinauf und herunter und tragen manchmal die Namen verborgener Flüsse; die Kleidung auf den Werbetafeln und in den Kettenläden aus synthetischem Material war irgendwann mal ein natürlicher Rohstoff, wurde irgendwann von Händen auf anderen Kontinenten genäht, vergiftete vielleicht jemandes Trinkwasser…und so weiter.
Wir können die Lücken nicht füllen
Wenn das Insektensterben die Bestäubung von Pflanzen gefährdet, muss diese von Menschenhand getan werden, doch über kurz oder lang können wir die Beziehungen, in denen wir natürliche Prozesse durch unsere eigene Technologie ersetzen, nicht aufrechterhalten. Wir können die Lücken nicht füllen, die entstehen, indem wir natürliche Prozesse zerstören und unterbrechen. Es mangelt uns nicht an Beziehungen zur Natur.
Wir haben viele Möglichkeiten, diese Beziehungen zu verbessern, die damit beginnen, sinnvoller, liebevoller, zu verbrauchen und zu gebrauchen. Es geht hier eben nicht nur um emotionale Beziehung, sondern die gelebte Beziehung, die ihr Ausdruck ist, und wirkungsvoll in unserer Welt existiert.
Warum sage ich liebevoll? Reicht nicht sinnvoll? Wir sind eine emotionale, spirituelle Spezies. Wie Nanabozho können wir aber durch die Welt gehen und Namen geben, sodass wir unsere Umwelt persönlich kennen, und sie als uns verwandt erkennen. Indigene Kulturen zeigen Wege die, aus gutem Grund, weiter gehen als pure Logik, die nicht nur auf intellektueller, sondern auf emotionaler und spiritueller Ebene mit uns sprechen. Was bedeutet „heilig“ für uns? Unantastbar?

Sand. Kreis. Foto: Johanna Jacobi
Bessere Konsumentscheidungen treffen
Was macht es mit uns, ein Wesen mit Namen zu kennen, zu bemerken und zu begrüßen? Wenn wir Glück hatten, dann hatten wir als Kinder einen Lieblingskletterbaum, oder einen Apfelbaum, dessen Früchte wir im Herbst ernten durften. Wenn wir diese Beziehungen auf die ganze Welt als ausweiten, wie wird es unser Denken und Handeln beeinflussen?
- Wird es einfacher, mutig, fordernd, auch schonungslos ehrlich gegenüber uns selbst und unseren Mitmenschen zu sein, wenn wir sehen wie unsere nicht-menschlichen Verwandten respektlos behandelt werden?
- Wird es sich sinnvoll anfühlen, anstatt unbedeutend und einschränkend, bessere Konsumentscheidungen zu treffen?
- Werden wir auf all die richtigen Arten dünnhäutiger, und auf die wichtigen Arten resilienter?
- Werden wir verstehen, dass wir alle auf derselben Seite stehen, der des gemeinsamen Überlebens, und gemeinsamen Gedeihens in einer möglichen Balance?
- Welche Veränderungen werden wir machen ganz einfach als Konsequenz der Bewusstwerdung über unsere schon bestehenden Beziehungen zur Umwelt?
- Werden wir bessere, wenn auch nicht einfache, Entscheidungen treffen, die uns glücklicher machen, und hoffentlich unser Überleben sichern, ohne in die Schuldlähmung moralischer Dogmen zu fallen?
- Werden wir dankbar sein können für jeden Moment der Geborgenheit, Schönheit und Gemeinsamkeit, und für jede Chance, die wir unseren verwandten Wesen geben können zu überleben?
Wir haben soviel zu gewinnen, wenn wir uns auf die nährenden, liebevollen, wechselseitigen und respektvollen Beziehungen konzentrieren, wo immer es uns möglich ist. Wir haben alle viel zu lernen und wir sind nicht allein. Selbst wenn die Menschen um mich herum hoffnungslos, nicht ansprechbar, feindselig, oder ängstlich sind, weiß ich, dass es solche gibt, die um ihre und unsere Heimat kämpfen, und ich bin ständig umgeben von Leben, welches auf derselben Seite steht wie ich. Von Wesen, die alle ihre eigene Geschichte haben, genauso wie ich.
Wen man liebt, nennt man beim Namen
Auf menschlicher Ebene brauchen wir ein Selbstverständnis und ein Verständnis von unserer allgegenwärtigen, immer wirksamen Beziehung mit der Welt, welches uns erlaubt, proaktiv und liebevoll mit dieser Krise umzugehen. Die Sprache der Wissenschaft kann bestimmt eine Art „love language“ in unserer Beziehung zur Natur sein, und muss nicht kalt und gefühllos sein.
Dass wir Gespräche zu diese Themen führen ist wichtig, aber auch insbesondere unser alltäglicher Sprachgebrauch hat eine große Kraft. Robin Wall Kimmerer erzählt von ihrer Beziehung zur Sprache ihrer Ahnen: im Gegenteil zur präzisen, aber gegenständlichen Sprache der Wissenschaft, hat Potawatomi, wie viele andere indigene Sprachen auf Nordamerikas, eine „Grammatik des Belebten“, (Kimmerer, 2021, 62, ff.).

Danke an Mike B @pexels. Krähe.
Neun Muttersprachler lebten noch zur Zeit der Entstehung des Buches, denn die Sprache ist durch die Entführung und Umerziehung indigener Kinder durch Kirche und Besetzerstaat beinahe verloren gegangen. Mit Seife wuschen die Missionare den Kindern den Mund aus, wenn sie ihre Muttersprache sprachen, als um Schmutz zu entfernen (Kimmerer, 2021, 65). Die Autorin verzweifelte fast, als sie begann, die schöne und äußerst komplizierte Sprache zu erlernen.
Sprache und Kultur gehören zusammen
Im Gegenteil zu Englisch ist Potawatomi nämlich eine Sprache, die auf Verben anstatt auf Nomen basiert, von denen alle konjugiert werden müssen. So gibt es Vokabular für „ein langer Sandstrand sein“; „rot sein“; und „eine Bucht sein“ (Kimmerer, 2021, 70). Kimmerer beschreibt ihre anfängliche Frustration, bevor sie die Schönheit einer Sprache zulassen konnte, die natürliche Elemente aus der Eingrenzung der Menschen frei ließ.
Als Verb gehört die Bucht sich selbst, ist nicht Objekt, sondern aktiv.
Sie ist grammatikalisch genauso belebt wie unsere Familienmitglieder – denn die lebendige Welt ist eben unsere Familie. Die Liste des Leblosen auf Potawotami ist kurz, die des Lebendigen lang. Robin Wall Kimmerer lädt uns ein, durch eine Welt zu gehen, die nicht mechanisch ist, nicht einfach systematisch zu erfassen, sondern belebt, von Tierleuten und Pflanzenleuten, mit einer persönlichen, subjektiven Existenz und Erfahrungsebene. Auch eine weniger einsame Welt, in der wir Teil dieser lebendigen Welt sein dürfen. (Kimmerer, 2021, 75).
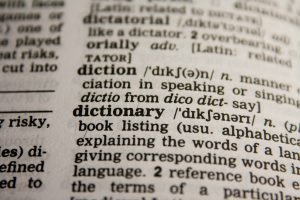
Worte. DeSelfie Danke an pexels
Sprache und Kultur gehören zueinander. Sowie Kultur unseren Sprachgebrauch definiert, so nutzen wir auch Sprache, um Kultur zu definieren, zu verstehen, zum Ausdruck zu bringen. Mich überkommt eine gewisse Sehnsucht, die sich fast wie Heimweh anfühlt, wenn ich lese, dass in Nord Sámi lange kein Wort für die Natur als Konzept existierte. Das Wort, welches heute so gebraucht wird, bezeichnete den Charakter, oder eben die Natur, gewisser Pflanzen oder Tiere, inklusive Menschen, nicht aber „die Natur“ als Ganze (wie wir sie als Humboldt’sches Konzept verstehen (Wulf, 2018)).
Namen erschaffen Beziehung
Hingegen sind Worte für „die Erde“, und „Land“, eng verwandt mit dem Wort für „Mutter“. Der Autor fragt, ob eine Kultur, die in bewusster Beziehung mit dem Land lebt und deren Menschen sich als Teil einer lebendigen Welt verstehen, Notwendigkeit hat für ein Wort, welches das Konzept von Natur als separat von menschlicher Kultur versteht – und ob das Wort selbst eine vorher nicht dagewesene Spaltung zwischen beiden kreiiert (Guttorm, 2021, 237, f.).
Wie Nanabozho lernte, indem er die Welt um sich herum benannte, erschaffen auch Namen Beziehung. Ortsnamen sind bei uns häufig offensichtlich, oder erzählen (manchmal sehr lustige) Geschichten. In Bayern gibt es die Orte Finsterwald, Kerschbaum, Stein und (einer meiner Lieblinge): Hoswaschen. Sprache erinnert uns aber auch in der Mitte einer Stadt, wo wir uns befinden. Fleet Street verläuft über dem Fluss Fleet, das kann man sich vielleicht denken. Nach manchen Namen muss man auf die Suche gehen: Westminster steht auf der Flussinsel Thorney Island, zwischen Nebenflüssen der Themse.
Wenn Worte verschwinden
Das Glockenbachviertel in München liegt – Überraschung – am Glockenbach. Wir kennen immer noch die Worte für viele uns geläufige Tiere und Pflanzen. Doch auch hier geht zu viel verloren, sodass zum Beispiel immer mehr Namen für die lebendige Welt in Kinderlexika durch Begriffe für Technologie ersetzt werden. Mit großem Erfolg haben Jackie Morris und Robert MacFarlane, ein britisches Schriftsteller-Künstlerduo, viele von diesen Worten in ihrem Buch “The Lost Words” poetisch zum Leben erweckt, Worte wie „conker“ Kastanie, „ivy“ Efeu, „lark“ Lärche, „raven“ Rabe, und „adder“ Kreuzotter (MacFarlane and Morris, 2017).

Danke an Elviss Railijs Bitäns pexels
Ich hoffe, dass die Kinder, die ohne diese Namen aufwachsen, trotzdem lernen, die Wesen zu bemerken, zu denen sie gehören, und dass sie sich eigene Namen ausdenken. Aber ich glaube, wir müssten ihnen dazu mehr Zeit, Freiheit, und die Erlaubnis geben. Deswegen würde ich mir wünschen, dass jedes Heim, jede Schule und jeder Kindergarten ein solches Buch wie The Lost Words ehren lernt.
Ein wertvolles Vermächtnis und das Ende der Einsamkeit
Die Philosophie des Einheimisch-seins, die Sprache des Lebendigen, bewegt uns in eine bewusstere Beziehung mit dem Rest des Erd-Organismus, und dieses Bewusstsein beeinflusst unsere Entscheidungen und führt zu bemerkbaren Veränderungen. Die Frage nach Beziehung zur Erde wirkt Reflektion in jeder Dimension unseres persönlichen, aber auch kollektiven Handelns aus.
Je mehr wir auch gemeinsam darüber reflektieren, und auch den Erfahrungen von Menschen Gehör schenken, die reziproke Beziehungen mit der nicht-menschlichen Welt eingehen (allen voran den indigenen Aktivisten und Weisheitshütern, aber relevanter weise auch den europäischen Innovatoren, Aktivisten, und Geschichtenerzählern), desto besser werden die kollektiven Entscheidungen sein, die wir für die Zukunft treffen. Selbstreflexion und Heimat.
Wir brauchen Gemeinschaft, denn im Alleingang können wir keine übergreifenden, detailreichen Lösungen für die Konflikte anbieten, die durch Systeme und Handlungsweisen entstanden sind. Die selbst über Jahrtausende dynamische Entwicklungen durchgemacht haben. Ich bin keine Expertin für Wirtschaft mit fossilen Energien. Ich bin nicht Kohlearbeiterin in Wales, ich bin nicht Politikerin, ich bin nicht Kleinbäuerin in Chile, und ich bin nicht indigen.
Wenn Beziehung zu Heimat bewusster wird
Meine eigene Beziehung zur unserer Erde ist nicht rein, und friedlich, und harmonisch, oder vollendet, sondern geprägt von all den menschlichen Bedürfnissen, die mich auch in Ungleichgewicht mit dem Rest der Welt bringen können. Mit der Zeit aber wird sie tiefer und bewusster – sie beeinflusst meine Entscheidungen und Gewohnheiten stärker. Und ich habe aber auch das Bedürfnis nach Heimat, nach Beziehung mit dem Land, dem ich in jedem Sinn gehöre.

In unseren Händen. Foto: Johanna Jacobi
Ich glaube, dass wir alle nach dem Gefühl von Heimat streben, und dass wir daran gewinnen, wenn wir Heimat als dynamische Beziehung zulassen. Verantwortung zu übernehmen heißt die Schuldspirale zu verlassen, die uns durch Angst um unsere Moral davon abhält alle Aspekte unserer ökologischen Beziehungen zu erkennen.
Verantwortung zu übernehmen bedeutet unsere Beziehungen über unseren persönlichen Stolz und Status zu stellen. Und anzufangen miteinander zu kommunizieren – nicht um Recht zu haben, oder auf der „richtigen Seite“ der Geschichte gewesen zu sein, sondern um Lösungen zu finden, welche die wundersamen Beziehungen unserer Ökosysteme, und den Reichtum der Artenvielfalt dieses Zeitalters schützen und zu fördern, damit wir weiter auf diesem Planeten zuhause sein dürfen.
Heimat als lebendiges Ökosystem begreifen
Wir haben alle Konzepte von Heimat: wo wir herkommen, was und wen wir brauchen, um uns zuhause zu fühlen, wo wir uns niederlassen. Für manche von uns ist Heimat vielleicht kein bestimmter Ort mehr. Meine Ahnen kommen von verschiedensten Orten in Europa, und nicht von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin.
In der Kultur der Māori in Aotearoa Neuseeland ist es üblich sich vorzustellen, indem man den Berg, den Fluss, den Ozean von dem man stammt, nennt (Elder, 2020, 3). Meine beste Freundin und Schwester wohnt auf der anderen Seite des Planeten, und auch sie bedeutet für mich Heimat. Unser Bewusstsein hat sich geändert, Menschen reisen, emigrieren, oder müssen fliehen. Wir alle teilen diesen Planeten als Heimat.
Für uns alle ist die Voraussetzung zum Überleben, zum irgendwo einheimisch sein, trinkbares Wasser, nahrhaftes Essen, gesunde Luft, respektvolle Sozialgefüge. Das Umdenken von Heimat, sodass sie gesamte lebendige Ökosysteme, ja unsere ganze Welt umfasst, stellt gewiss mehr Fragen als es beantwortet und viele sind nicht einfach. Sie beschäftigen sich nicht nur mit Leben, sondern auch mit Tod, nicht nur mit Bewusstwerdung, sondern auch damit, dass wir als Individuen in Vergessenheit geraten werden.
Es geht um eine dynamische und bewusste Beziehung
Sie beschäftigen sich mit der Möglichkeit unseres Scheiterns. Und sowohl mit dem, was uns von anderen Lebewesen unterschiedet, wie auch damit, was uns verbindet. Sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf persönlicher und kultureller Ebene setzen sich immer mehr von uns mit diesen Fragen auseinander. Es geht darum, Umgangsweisen zu entwickeln, die gewiss von unserem Glauben, unserem Erfahrungsschatz geprägt sind, aber weniger aus dogmatischen Glaubenskonstrukten entstehen, und mehr aus einer dynamischen und bewussten Beziehung.
Was bedeutet es, ein guter Verwandter für unsere Mitwelt zu sein? Was bedeutet es, ein guter Vorfahre für unsere Kinder und Kindeskinder, oder die unserer Freunde zu sein? Wie können wir kollektiv und liebevoll Verantwortung übernehmen? Was bedeutet Heimat? Robin Wall Kimmerer, gelehrt von Wissenschaftlern und indigenen Wissensträgern, und vor allen von der Erde selbst, hat viele Fragen an mich herangetragen, und vor allen Dingen lege ich allen Geflochtenes Süßgras ans Herz, welches als Hörbuch bei mir in Wiederholschleife läuft.
Von den Kenntnissen indigener Kulturen lernen
Über soziale Medien kann man auch von indigenen Aktivisten und Lehrern viel aus erster Hand erfahren. Und zu Geschichte und Initiativen, wenn man sich zum Beispiel die offiziellen Webseiten indigener Nationen ansieht. In Podcasts wie All My Relations, produziert von Mitgliedern der Swinomish and Tulalip, sowie Cherokee Nation, kann man sich auch informieren.
Dass wir heute noch die Möglichkeit haben, von den Kenntnissen indigener Kulturen zu lernen, liegt an deren Resilienz im Angesicht brutaler kolonialer Übermacht. Allein deswegen finde ich es wichtig, solidarisch zu sein und sich den Herausforderungen und Bedrohungen bewusst zu sein, denen indigene Menschen und Gemeinden heutzutage gegenüberstehen. Ich lege gerade auch besonders Wert darauf, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die direkt um Europa gehen, sowie die Beziehung Europas zum Rest der Welt.
Die Klimakrise als Kulturkrise
Mich interessieren Rewilding Initiativen, vor-christliche Gesellschaften und Religionen, aber auch die Herausforderungen, denen Landwirte heute gegenüber stehen. Integration von Heimatsuchenden und Flüchtlingen, Achtsamkeits- und Dankbarkeitsrituale, die Beziehung von Kindern zur nicht-menschlichen Welt, und Tierwohl.
Ich nehme die Klimakrise als Kulturkrise wahr, und denke viel über die Rolle von Kunst und Kreativität in unserem Umgang mit ihr nach. Als Künstlerin sehe ich die Bewältigung dieser Kulturkrise als mein Aufgabengebiet, so wie eine Meeresbiologin den Schutz der Ozeane als ihres sieht.
Aber allem voran versuche ich mehr und mehr die lebendige Welt als Lehrerin anzunehmen. Selbst als vermeintliches Landei braucht das Zeit, und vor allem Aufmerksamkeit. Was es mir gibt, ist nicht nur künstlerische Inspiration, Wissen um natürliche Rhythmen, und Respekt für die, die um mich herum leben. Es schenkt mir auch eine persönliche Beziehung; Balsam für die Art von Einsamkeit, die vom Abgeschnittensein von der Natur kommt; Kraft; und die wundersame Medizin der Dankbarkeit und Freude.
Geschichte verleihen, Geschichten schreiben
Ich bin an der Würm aufgewachsen. Meine Vorfahren kommen von der Ostsee. Meine Großmutter wohnt am Wallberg. Mich hat die Erde Bayerns genährt, wenn ich Durst hatte, habe ich englisches Wasser getrunken. Aber ich wurde auch von Importware ernährt, von Händen erarbeitet, die ich nie kennen werde, ich kleide mich in Materialien, deren Geschichte ich nicht kenne.
Die Wände des Reihenhauses, in dem ich in London wohnte, sind aus rotem Backstein – ich kenne auch seine Geschichte nicht. Der Becher auf meinem Schreibtisch wurde von Händen geformt, die ich durchaus kenne, auf einer Insel, die mir viel bedeutet, und auf der ich doch nur Besucher bin – obwohl die Insulaner zu wissen scheinen, dass wir das in der Tiefe der Zeit alle sind.
Ich weiß nicht, wo der Baum einmal stand, auf dessen Seiten Robin Wall Kimmerers Worte gedruckt worden sind. Aber ich kann mir bewusst machen, dass es einmal ein Baum war, und das Buch behutsam behandeln, damit es noch von vielen gelesen werden kann. Ich kann es ausleihen, weitergeben, ihm eine Geschichte verleihen, die es über mein Wandregal hinausschafft. Eine dieser Geschichten ist die, die ich gerade schreibe, und die du, in einer anderen Zeit, gerade liest. Sie ist in einem Datenzentrum gespeichert, das ich nicht kenne.
Wir haben viele Gelegenheiten, Beziehungen wahrzunehmen
Die Krise, in welcher wir als ganze Menschheitsgemeinschaft stecken, ist in sehr bedeutendem Maße eine Kulturkrise, in der es einer tiefen und zunehmend rascheren Anpassung bedarf. Um den Herausforderungen unserer Zukunft entgegenzusehen, ist mehr als eine Justierung unserer Gewohnheiten gefragt.
Und obwohl wir dank Buchdruck und moderner Informationstechnik Zugriff auf die theoretischen Kenntnisse zu vielen Kulturen haben, und aus den Geschenken, welche indigene Erzählerinnen mit uns teilen auf lebendige Weise lernen dürfen, ist auch eine Kopie, oder schlimmstenfalls kontextlose Übernahme anderer Kulturen weder respektvoll, noch sinnvoll.
An der Stelle sehe ich stattdessen die Forderung, und wunderbare Gelegenheit, eine Handlungs- und Lebenssprache zu schaffen: ein kulturelles Vokabular, eine lebendige Geschichte, und erfüllende Beziehungen, welche sich aus unserem jeweiligen eigenen kulturellen Erbe, unseren eigenen Lebensgeschichten, aus unserer Heimat, und aus unseren wahren Bedürfnissen und Wünschen entwickeln.
Wir haben so viele Gelegenheiten, unsere Beziehungen wahrzunehmen, und neue zu formen: liebevolle, dynamische, respektvolle, reziproke Beziehungen. Die Welt um uns und in uns mit einem Sinn für Wunder zu betrachten. Wechselseitige Beziehungen zwischen Spezies als heilig zu sehen, uns nicht über unsere Mit-Wesen zu stellen. Sondern sie als unsere älteren, weiseren Geschwister zu sehen, das alles kann unsere Leben auf einfache und wirksame Art bedeutungsvoll, schön, lebenswert machen.
Eine essenziell menschliche und notwendige Art zu leben
Für mich ist es eine essenziell menschliche und notwendige Art zu leben. Sie kann es uns möglich machen, in der scheinbar unvereinbaren Brutalität und grenzenlosen Schönheit unserer Welt in der Gegenwart zu leben, Perspektive zu wechseln, zu verstehen, wie unsere Leben sowohl klein als auch grenzenlos, sowohl verschwindend bedeutungslos, und immer wirksam sind. So zu lieben, zu denken, und zu handeln, als ob wir bleiben wollen, wird uns bereichern, und uns erinnern, dass wir nicht allein sind, nicht in unserer Trauer um, und ganz gewiss nicht in unserer Freude an dieser Welt.
Hier ist mehr zu erfahren über den Kampf der Sámi gegen Landnahme durch die norwegische Regierung: https://www.youtube.com/watch?v=lMXIS5SlIv4 (ABC News Australia). Die deutsche Berichterstattung ist schwierig zu finden.
In tiefer Dankbarkeit für Robin Wall Kimmerers Arbeit und alle Quellen ihres Wissens und ihrer Weisheit. In Dankbarkeit für Land und Wesen, die mich nähren, lehren und lieben. Dank gilt auch den friedlichen, ungehorsamen Aktivisten und Naturschützern, die ihre Zeit und Kraft spenden, und oft selbstlos Freiheit und Leben aufs Spiel setzen, und damit der Erde und uns allen dienen. Vielen Dank dem Knepp Wildland Project in Sussex, den Poeten und Wissenschaftlerinnen, die meine Quellentexte verfasst haben, und Dr. Astrid Dobmeier für ihre Geduld und ihr Vertrauen.
Quellen
All My Relations Podcast (2022) 37 Episoden. https://podcasts.apple.com/us/podcast/all-my-relations-podcast/id1454424563 [accessed 11 October 2022]. (Podcast produziert von Dr Adrienne Keene (Cherokee Nation) und Matika Wilbur (Swinomish and Tulalip)).
Big Think (2017) Human Nature: Paleolithic Emotions, Medieval Institutions, God-Like Technology |E. O. Wilson Available from https://www.youtube.com/watch?v=_s30m6Bpj2U [accessed 11 October 2022].
Die Bibel [Lutherbibel]. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
Chivers, T. (2021) London Clay. UK: Penguin Random House.
Cwienk, J. (2019) Wieso deutscher Müll eben doch im Meer landet. Deutsche Welle, 24 Januar. Available from https://www.dw.com/de/wieso-deutscher-m%C3%BCll-eben-doch-im-meer-landet/a-47198039 .
Elder, H. (2020) Aroha: Māori wisdom for a contented life lived in harmony with our planet. New Zealand: Penguin random House.
Guttorm, H. E. (2021) “Becoming Earth: Rethinking and (Re-)Connecting with the Earth, Sámi Lands, and Relations.” In Bridging Cultural Concepts of Nature: Indigenous People and Protected Spaces of Nature, edited by Rani-Henrik Andersson, Boyd Cothran and Saara Kekki, 229–258. Helsinki: Helsinki University Press. DOI: https://doi.org/10.33134/AHEAD-1-8 [accessed 11 October 2022].
Halliday, T. (2022) Otherlands. Dublin: Allen Lane, Penguin Random House.
Jepson, P. and Blythe, C. (2020) Rewilding. London: Icon Books Ltd.
Kimmerer, R. W. (2020) Braiding Sweetgrass. 2nd Edition. Dublin: Penguin Random House.
Kimmerer, R. W. Read by the author.
Kimmerer, R. W. (2021) Geflochtenes Süßgras. Übersetzung: E. Ranke, W. Ströle, F. Pflüger. Zweite Auflage. Berlin: Aufbau.
Kimmerer, R. W. München: Geflochtenes Süßgras. Übersetzung: E. Ranke, W. Ströle, F. Pflüger. Gelesen von Eva Mattes. BonneVoice
Lovelock, J. (2006) We Belong To Gaia. Dublin: Penguin Random House.
MacFarlane, R. and Morris, J. (2017) The Lost Words. UK: Penguin Random House.
Norms, L. (2022) Bargain Bin Rom-Com. Portishead: Burning Eye Books.
Sheldrake, M. (2020) Entangled Life. UK: Penguin Random House.
Tarbuck, A. (2020) A Spell in the Wild. London: Two Roads.
Tree, I. (2019) Wilding. London: Picador, Pan Macmillan.
Wulf, A. (2015) The Invention of Nature. London: John Murray.
Wulf, A. (2018) Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Übersetzung: H Kober. Zweite Auflage. München: C. Bertelsmann Verlag.
WWF Deutschland (2020) Soja als Futtermittel. Berlin: WWF Deutschland. Available from https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/produkte-aus-der-landwirtschaft/soja/soja-als-futtermittel [accessed 11. October 2022].
Schreibe einen Kommentar